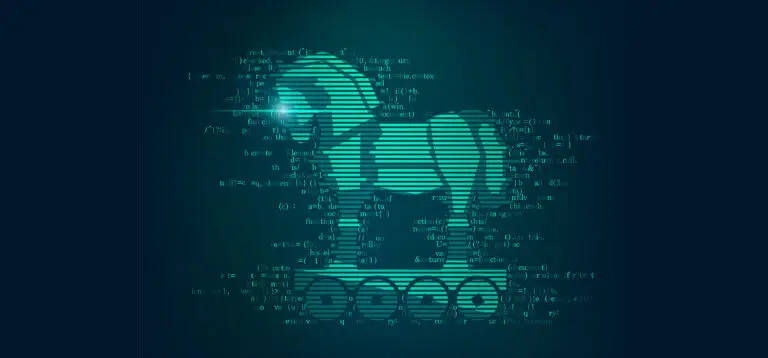Das Wort und dessen Bedeutung, wenn wir von Trojanern sprechen, kennen Sie bestimmt bereits. In der Regel ist die Rede von einem Computervirus, der sich unter einem Deckmantel versteckt. Auch im deutschen Verfassungsschutz gibt es solche Trojaner – da geht es jedoch um sogenannte Staatstrojaner. Das sind solche IT-Viren, die direkt von staatlichen Behörden zum Einsatz kommen. Wir schauen uns heute an, was die „legalen Schädlinge“ so alles können und vor allem, wann deren Einsatz erlaubt ist.
Staatstrojaner im Verfassungsschutz
Der deutsche Verfassungsschutz unterliegt dem entsprechenden Bundesamt, und zwar dem BfV. Dieses Amt besitzt bereits die Lizenz, die es gestattet, mithilfe von Staatstrojanern Chats, Telefonate und Video-Konferenzen abzuhören.
Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle kurz auf, wie ein Staatstrojaner genau funktioniert. Trojaner sind Programme, die auf Computern oder mobilen Netzwerkgeräten eingeschleust werden. Einmal dort angelangt, übernehmen sie eine eigenständige Funktion. In der Regel erfolgt dies über eine Installation im Hintergrund – der Endnutzer weiss also nicht einmal etwas von der Existenz des Trojaners.
Staatstrojaner können quasi all das, was „normale“ Trojaner auch aufweisen. Sie lesen Daten aus, zeichnen sie auf, speichern sie an anderer Stelle und die „besten“ unter ihnen manipulieren die Zielgeräte ganz nach Belieben.
Trojaner nichts Neues im Verfassungsschutz
Innerhalb der Strafverfolgung befinden sich Staatstrojaner bereits seit dem Jahr 2006 im aktiven Einsatz. Entwickler sind eigens dafür abgestellte Experten des Bundeskriminalamts (BKA). Schon kurz nach der Einführung gab es diverse Anfragen, beispielsweise vonseiten des Zollkriminalamts.
Im Jahr 2008 definierte das BfV allerdings strenge Vorgaben für den Einsatz von Staatstrojanern. Der eigentliche Zweck des Programms ist nämlich ausschliesslich die Eindämmung und Bekämpfung terroristischer Aktivitäten.
Was ist neu?
Das Bundesinnenministerium reichte kürzlich einen Entwurf ein. Dieser fordert eine Anpassung des Verfassungsschutzrechts. Besagter Entwurf sorgte unlängst für Aufruhr, denn dessen Inhalte sind nicht so, wie zuvor mit dem Koalitionspartner abgestimmt.
Der Vorschlag besagt, dass in Zukunft sämtliche Geheimdienste von Bund und Ländern die Lizenz für den Einsatz von Staatstrojanern erhalten. Das widerspricht den aktuellen Grundlagen des Fernmeldegeheimnis.
Käme der neue Gesetzesentwurf zur Anwendung, dürften dann neben dem BfV unter anderem auch der Bundesnachrichtendienst (BND) sowie der militärische Abschirmdienst (MAD) und ganze 16 andere Ämter die Telekommunikation „anzapfen“.
Aggressiverer Staatstrojaner in Wahrheit „entschärfte“ Version
Obwohl der aktuellste Gesetzesentwurf schon recht krass klingt, gab es im Vorfeld noch weit mehr Forderungen. So verlangte ein anderer Vorschlag zum Beispiel sogar ein Recht für Agenten, Wohnräume von Verdächtigen betreten zu dürfen.
Der aktuell diskutierte Entwurf des Staatstrojaners zielt derweil darauf ab, dass zusätzlich auch sogenannte ruhende Kommunikation analysiert werden darf. Wer sich etwas auskennt, ahnt allerdings, was das bedeuten würde. Der Staatstrojaner müsste so lange auf dem Zielgerät fungieren, bis ein Verdacht effektiv bestätigt oder widerlegt ist. Auch von heimlichen Online-Durchsuchungen im Falle „besonderer Umstände“ war ursprünglich die Rede. Da diese Beschreibung für die Gesetzgebung nicht ausreichend definiert war, fand sie keine entsprechende Zustimmung.
Kompromiss für den Staatstrojaner
Die neue Befugnis für das BfV beinhaltet die sogenannte Quellen-TKÜ. TKÜ steht für Telekommunikation-Überwachung. Der Unterschied zur normalen Überwachungsvariante besteht darin, dass die Abhörung ohne vorherige Ver- oder Entschlüsselung auf dem Zielsystem erfolgt. Die Überwachung greift somit für einen laufenden Austausch.
Die Massgabe betrifft demnach Kommunikationen im weitreichenden IT-Bereich. Sie greift für Telefonate via Internet – somit beispielsweise auch Video-Chats via What’s App, Konferenzen über Google Meet oder Skype.
Angst um ihre Privatsphäre müssen unbescholtene Bürger jedoch nicht haben. Die Befugnisse des BfV werden zwar unter Umständen erweitert, aber die Politiker sind sich laut eigenen Aussagen über die fliessenden Grenzen sowohl gesetzlicher Massnahmen als auch Anzahl an IT-Schnittstellen im Falle von Staatstrojanern durchaus bewusst.
Wir werden sehen, ob der oberste Kläger vor dem Bundesgerichtshof, mit seiner Devise der fehlenden Rechtsgrundlage für eine so weitreichende Abhörung-Methodik, weiterhin erfolgreich bleibt.